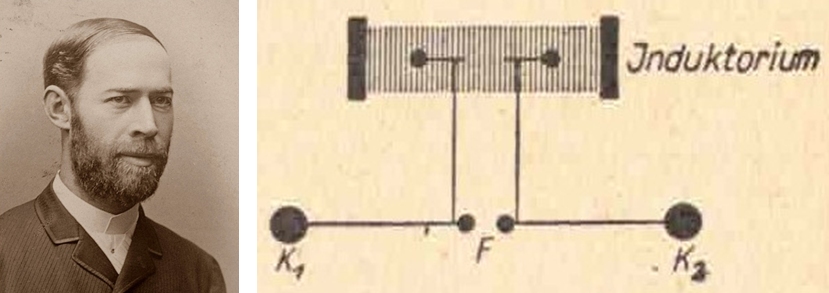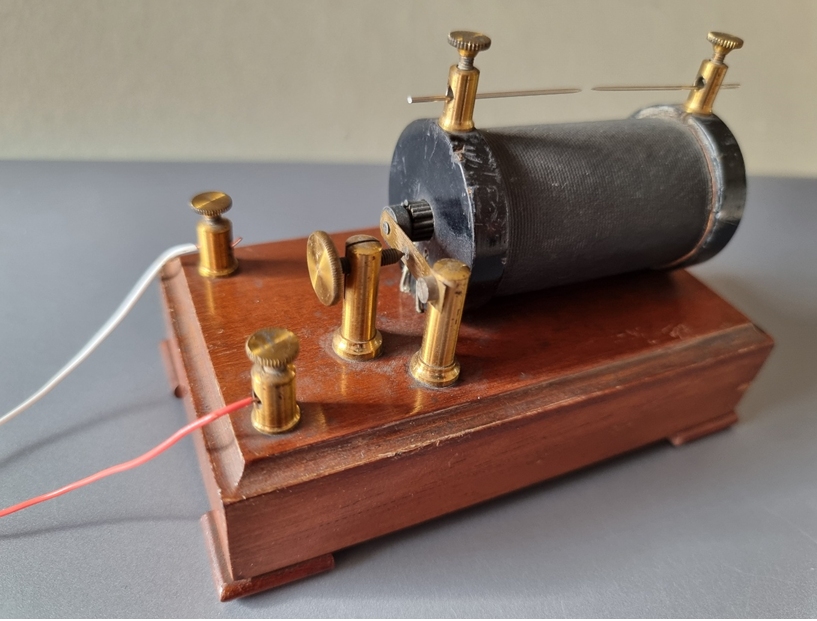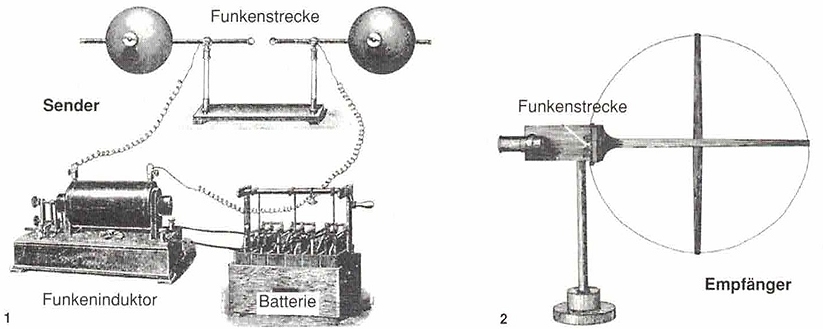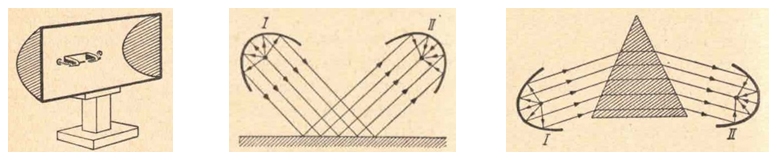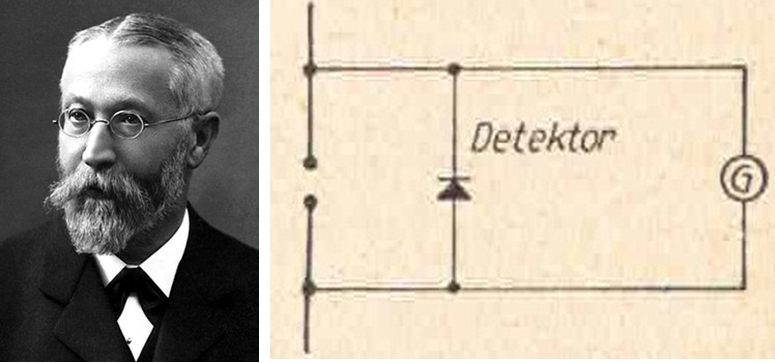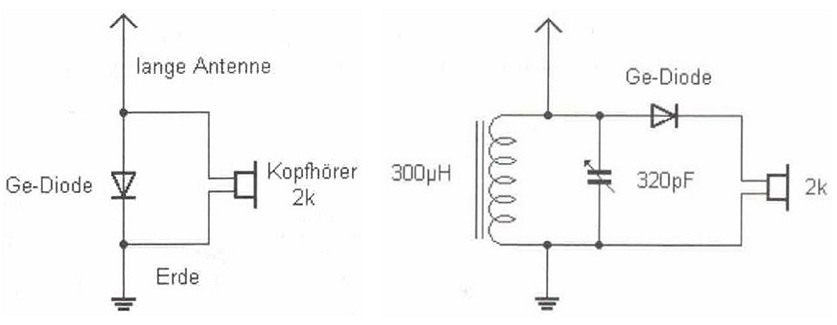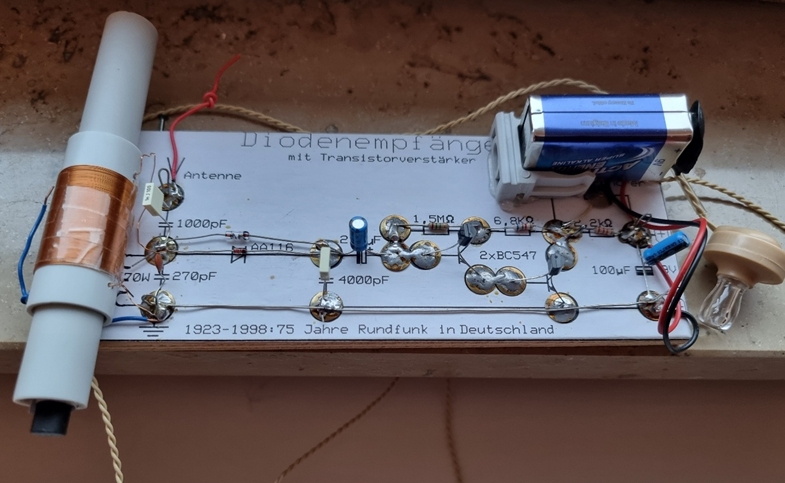Vom Hertzschen Dipol zum Detektorradio
von Klaus Leder
Im
Jahr 1886 spannte der 29jährige Physikprofessor Heinrich Hertz im
Hörsaal des Karlsruher Polytechnikums einen 3 m langen Kupferdraht auf,
der in der Mitte durch zwei nahe beiander liegende kleine Messingkugeln
unterbrochen war. An den Drahtenden dieses Dipols waren große
Messingkugeln als Kondensatoren (K) angebracht. Die inneren
Messingkugeln schloss er an einen Rühmkorff-Induktor an.
Die Induktionsspule mit Eisenkern hatte einen Unterbrecherkontakt
(Wagnerscher Hammer). Beim Anschluss an eine Gleichstromquelle konnte
Hertz Hochfrequenzimpulse erzeugen, die Funkenüberschläge an der
Funkenstrecke (F) verursachten. An einem zweiten, ebenfalls in der
Mitte unterbrochenem Draht, der in einem Holzrahmen befestigt war,
entdeckte Hertz mit einer Lupe winzige Funken, wenn er sich mit diesem
Resonator dem Sender annäherte. Offenbar erzeugten die
Funkenüberschläge elektromagnetische Wellen, die sich im Raum
ausbreiteten. Sender- und Empfängerdipol waren offene Schwingkreise für
Wellen im Dezimeterbereich.
Heinrich Hertz untersuchte mit weiteren Experimenten die Eigenschaften
der elektromagnetischen Wellen. Für Reflexionsversuche
baute er parabolische Zylinderspiegel aus Zinkblech. Senderdipol und
Empfängerdipol befanden sich jeweils in der Brennlinie. Ein Versuch mit
einem Prisma aus Pech zeigte die Brechung elektromagnetischer Wellen.
Die Interferenz der Wellen wurde mit dem Fresnelschen Spiegelversuch
demonstriert. Auch Beugungserscheinungen an Spalten und Hindernissen
und die Polarisation der Wellen konnten nachgewiesen werden. Bei
Reflexionsexperimenten konnte Hertz mit seinem kreisförmigen
Empfängerdipol Knoten und Bäuche der stehenden elektromagnetischen
Wellen wahrnehmen und damit deren Ausbreitungsgeschwindigkeit
berechnen. Das Ergebnis entsprach der Lichtgeschwindigkeit. Die von dem
schottischen Physiker James C. Maxwell 1866 theoretisch vorausgesagte
Existenz elektromagnetischer Wellen wurde 1886 durch diese
Experimente von Heinrich Hertz bewiesen und die Wesensgleichheit von
Licht und elektromagnetischen Wellen aufgezeigt.
Am Empfängerdipol hatte Hertz eine Lupe zur Registrierung der Funken
angebracht. Der französische Physiker Edouard Branly ersetzte die
Funkenstrecke durch einen Kohärer, einem kleinen mit Metallpulver
gefüllten Glaszylinder. Unter der Einwirkung eines elektromagnetischen
Impulses veränderte sich der elektrische Widerstand des Kohärers. In
den 1890er Jahren konnte in einem Stromkreis mit dem Kohärer ein Signal
empfangen und mit Hilfe eines angeschlossenen Relais telegrafisch
weitergeleitet werden. Der Straßburger Physiker Ferdinand Braun hatte
1874 den Gleichrichtereffekt von Halbleitern entdeckt, als er auf
Kristalle von Metallsulfiden eine Drahtspitze aufsetzte. Der
Hochfrequenzgleichrichter aus Bleiglanz ermöglichte es, die
Feldstärke eines Signals mit einem empfindlichen Galvanometer (G) zu
messen .
Mit Sprache oder Musik modulierte Wellen konnten 1899 mit der
Kristalldiode demoduliert und die Nachricht mit einem
elektrodynamischen Kopfhörer hörbar gemacht werden.
Zur Abstimmung auf eine Senderfrequenz diente zunächst ein
Schiebespule. Später konnte mit Germaniumdioden und einem Schwingkreis
aus Spule und Drehkondensator der Detektor auf Sendefrequenzen
abstimmbar gemacht werden.
Bei neueren Bausätzen kann die Resonanz mit einem Sender durch
Verschieben eines Ferritkerns in der Schwingkreisspule eingestellt
werden. Bis heute hat der Empfang von Radiowellen ohne Batterie mit
selbstgebauten Detektorempfängern seine Faszination nicht verloren.
Die Entdeckung des Funkensprungs durch Hertz hatte zur Folge, dass
später drahtlose Übertragungen rund um den Globus und weit in den
Weltraum möglich wurden. Auch Radartechnik und Handy-Technologie
beruhen auf den Entdeckungen von Heinrich Hertz.