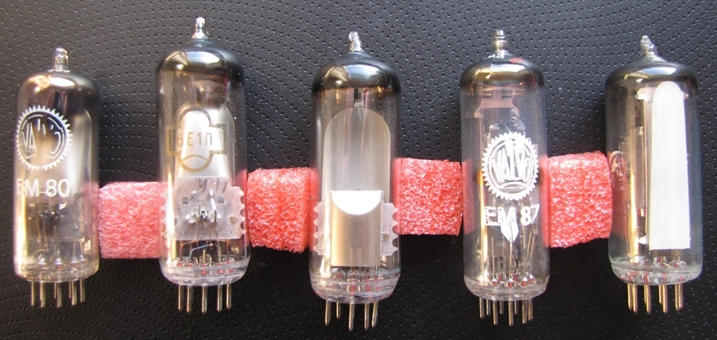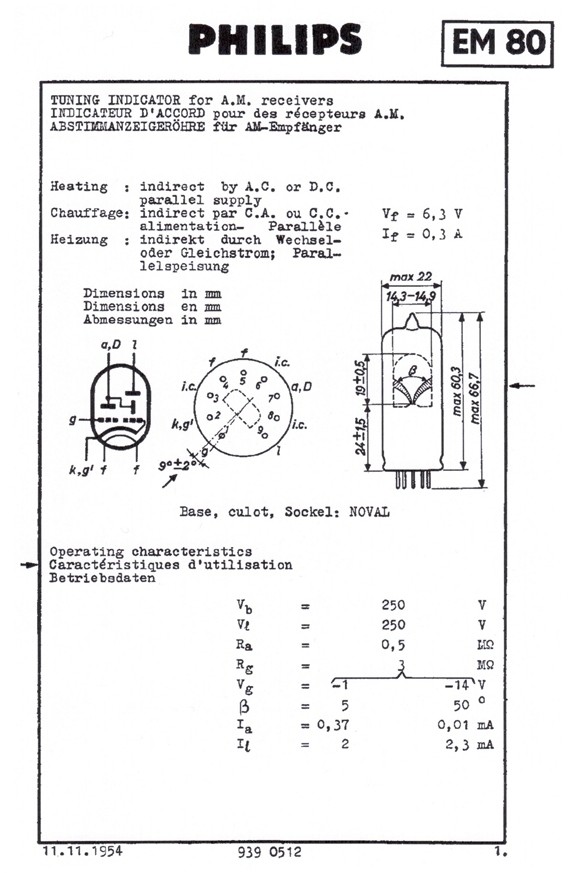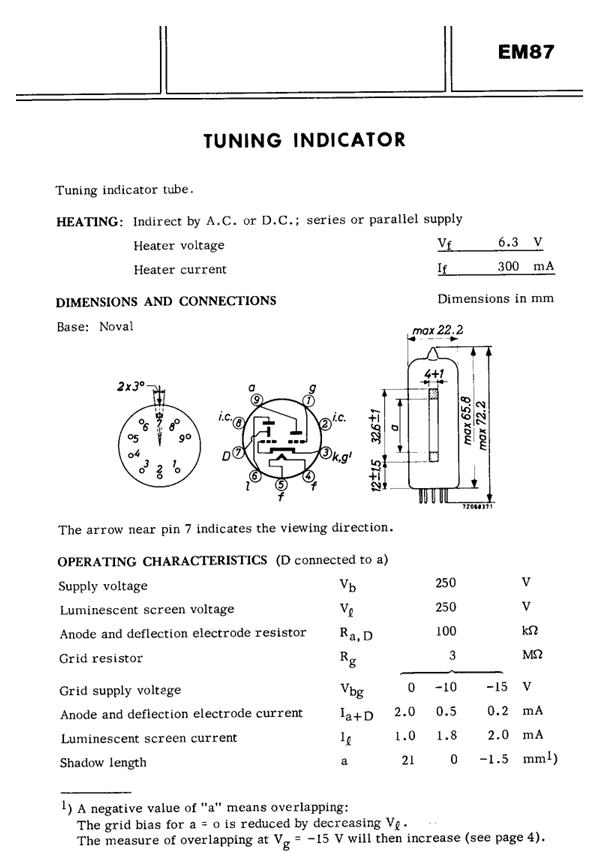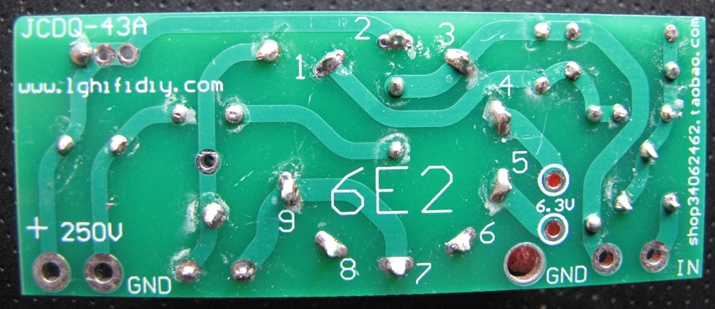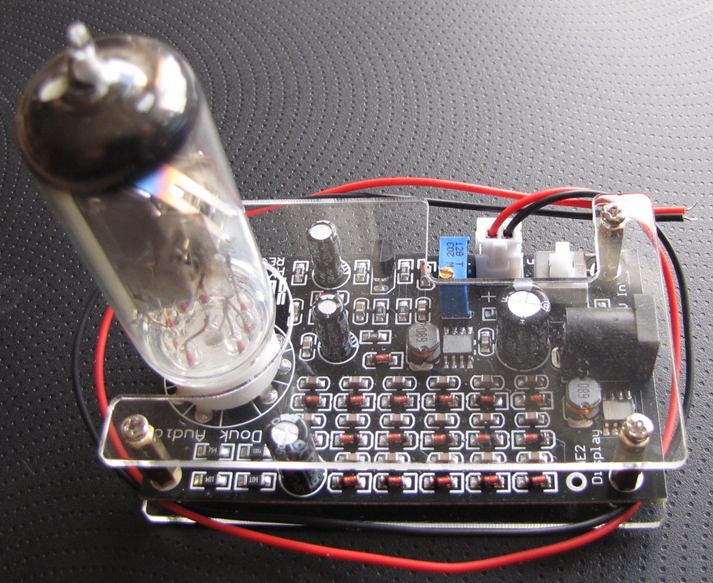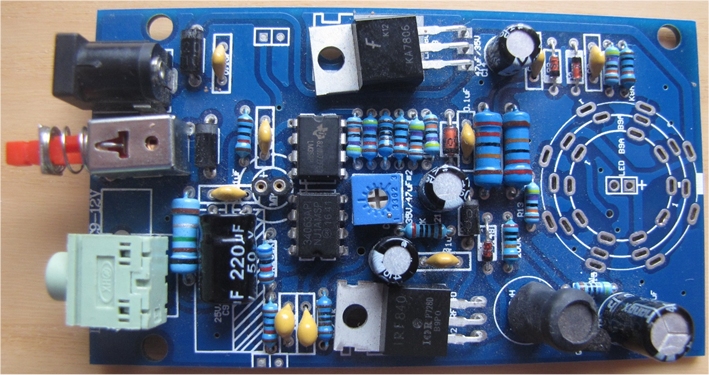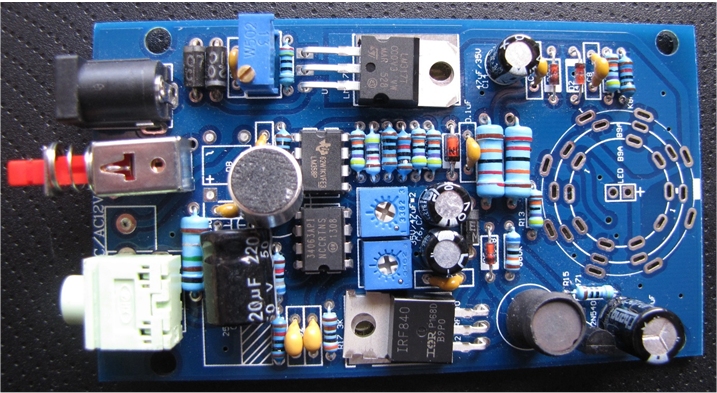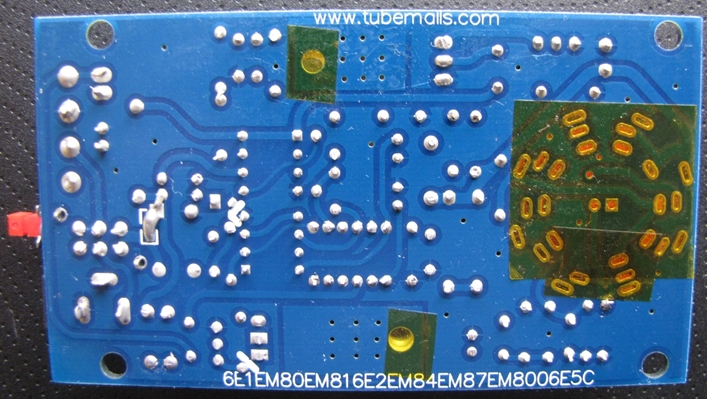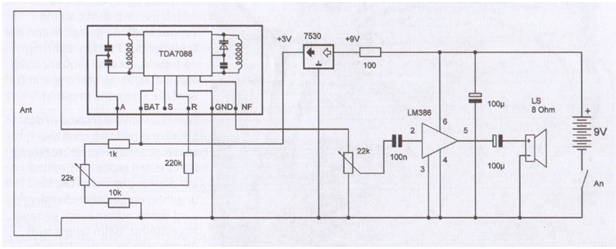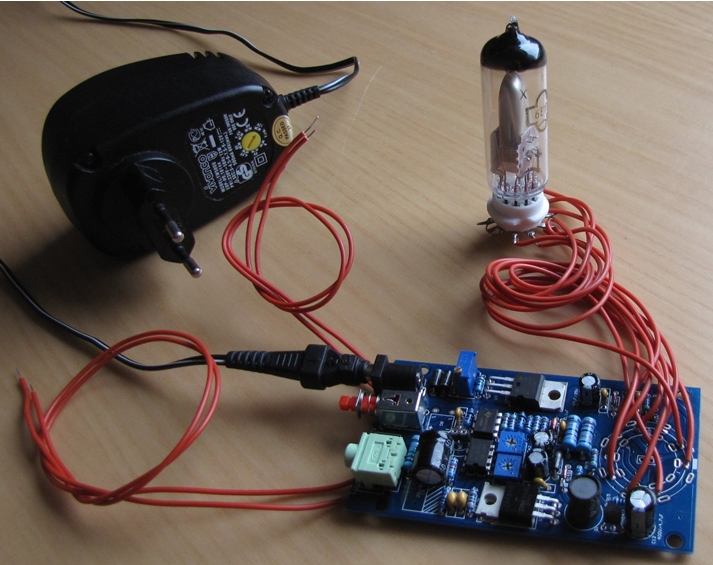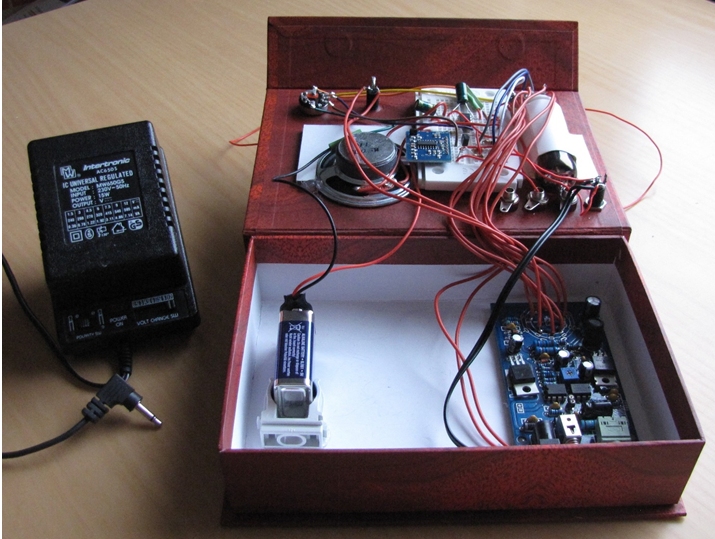Magischer Fächer 6E1 und Magisches Band 6E2 im Retroradio
von Klaus Leder
Abb. 1: Anzeigeröhre 6E1 und UKW-Empfänger im Retroradiogehäuse von Conrad
„Magische Augen“ sind ein typisches Merkmal der Röhrenradios der 1950er
und 1960er Jahre. Sich bewegende, grün strahlende Kreissegmente, ein
sich öffnender, grüner Fächer oder ein flackerndes, blaugrünes Band
dienten zur Abstimmung auf eine Sendefrequenz oder zur Aussteuerung von
Tonbandgeräten. Neben der Zeitung war damals das Röhrenradio mit der in
warmen Licht leuchtenden, großen Senderskala und dem Magischen Auge das
wichtigste Medium, um das sich abends die Familie wie um ein Lagerfeuer
versammelte, um Nachrichten von nah und fern zu hören. Mitte der 1950er
Jahre übernahm der Fernseher diese Funktion, zunächst mit
schwarz-weißen Bildern, seit 1967 mit Farbbildschirm. Mit der
Entwicklung der Transistorradios und -verstärker in den 1960er Jahren
verschwanden die Heiz- und hohe Anodenspannungen erfordernden
Vakuumröhren und mit ihnen die grün leuchtenden „Magischen Augen“.
Drehspulinstrumente übernahmen die Anzeige der Empfangsfeldstärke und
der Aussteuerung von Verstärkern. Später erfüllten Balkenanzeigen mit
Leuchtdioden diese Aufgaben. Im Zeitalter des Smartphones und der
DSP-Radios erwecken Design und Bedienungsweise eines Retroradios wieder
das Interesse vieler Menschen. Alte Gehäuseformen,
Wellenbereichsgraphiken, Tastenschalter und Drehknöpfe lassen
Erinnerungen an die technischen Wurzeln des Radios und den damaligen
warmen Charme der analogen Elektronik wachwerden und beflügeln die
Designer. Vielleicht ist diese Rückbesinnung eine Reaktion auf die
kalte, undurchschaubare Technik der Mikroelektronik und
Digitalisierung, deren rasante Entwicklung bei vielen Menschen
Irritation und Zukunftsängste auslösen. In Restaurants und
Wohnzimmerecken werden neuerdings fahle Halogen- und Energiesparlampen
durch Birnen im „Edison-Style“ ersetzt, deren Optik warmes Licht und
Behaglichkeit vermitteln. Das Licht in den Glaskolben wird heute jedoch
nicht mehr von glühenden Kohlefäden, sondern von LED-Filamenten
erzeugt.
Der Retro-Stil hat inzwischen auch andere innovative Entwickler und
findige Verkäufer auf den Plan gerufen. Im Internet findet man Angebote
osteuropäischer Händler, die „Magische Augen“ verkaufen, wobei es sich
zumeist um alte russische Anzeigeröhren wie die 6E1 und die 6E2
handelt. Die 6E1 ist ein russischer Nachbau der westeuropäischen EM 80
(Magischer Fächer), die 6E2 entspricht der EM 87 (Magisches Band). In
Osteuropa wurden diese Anzeigeröhren längere Zeit hergestellt und in
Geräte eingebaut, denn die Halbleitertechnik ist in den USA erfunden
und entwickelt worden. Der verspäteten Nutzung der Halbleiter in den
Ländern des Ostblocks ist es zu verdanken, dass heute noch ein Bestand
dieser historischen Röhren vorhanden ist. Hochwertige Röhrenverstärker
aus China werden inzwischen wieder mit Magischen Augen als Blickfang
ausgestattet.
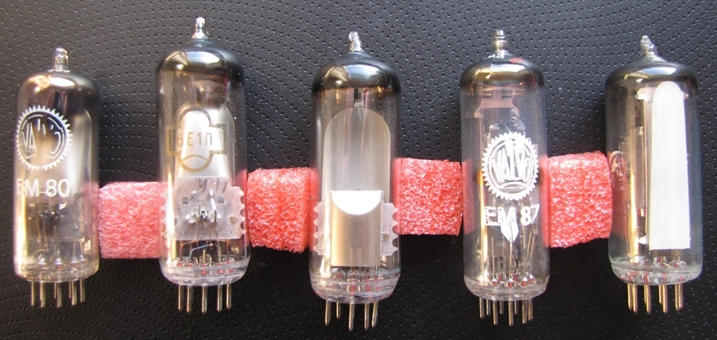
Abb. 2: Anzeigeröhren EM80, 6E1, EM87 und 6E2
Die ersten Abstimmhilfen in den 1930er Jahren besaßen an der Oberseite
der Elektronenröhre einen kegelförmigen, metallischen Schirm mit einer
fluoreszierenden Schicht aus Zinkorthosilikat. Durch auftreffende
Elektronen wird der Leuchtschirm zur Aussendung eines grünen Lichts
angeregt. Da der Kopf der Röhre wie ein leuchtendes Auge aussah, wurde
die Anzeige „Magisches Auge“ genannt. In den 1950er Jahren wurden
kleinere Anzeigeröhren entwickelt, bei denen der Leuchtschirm auf die
Seite der Röhren verlagert und so vergrößert wurde.
Beim „Magischen Fächer“ (z. B. EM80 und 6E1) hatte der Leuchtschirm
eine muschelförmige Form. Bei dem später gebauten „Magischen Band“ (z.
B. EM87 und 6E2) wurde die fluoreszierende Schicht direkt auf der
Innenseite des Glaskolbens aufgebracht. Wie die Datenblätter der EM 80
(Abb. 3) und der EM87 (Abb. 4) zeigen, handelt es sich um Doppelröhren,
bei denen neben dem Anzeigesystem noch eine Triode zur Verstärkung der
Steuerspannung im Glaskolben eingebaut ist. Geheizt werden die Röhren
mit 6,3 Volt DC/AC bei einem Heizstrom von 0,3 Ampere (f,f).
Zwischen der gemeinsamen Kathode (k) und der Anode (a) und dem
Leuchtschirm (l) liegt eine Betriebsspannung von 250 VDC an. Die
negative Steuerspannung, die je nach Röhrentyp zwischen -1 bis -15 Volt
liegt, wird an das Gitter (g) gelegt. Das Anzeigegitter (gl) ist intern
mit der Kathode verbunden. Steuerstege (D) formen den von der Kathode
ausgesandten Elektronenstrom zu Bündeln oder werfen einen Schatten auf
den Leuchtschirm. Die Leuchtflächen wachsen mit steigender
Steuerspannung, die früher von der Regelspannung für den
Schwundausgleich (ALC) geliefert wurde. Bei diesem Projekt wird die
NF-Spannung des Verstärkerausgangs als Steuerspannung genutzt. Die
Steuerelektroden sind bei der EM80 mit der Anode verbunden, bei der
EM87 sind sie an Pin 7 angeschlossen.
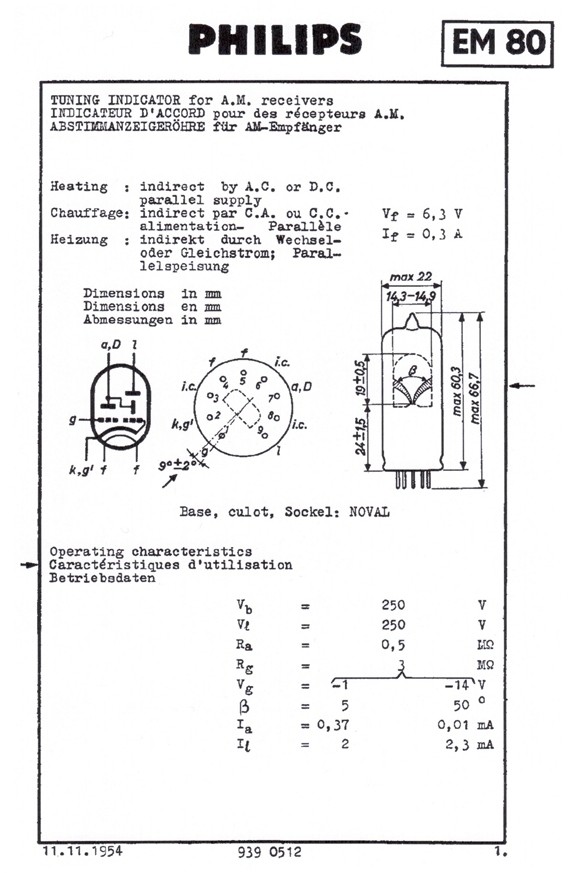
Abb. 3: Datenblatt von Philips für die Anzeigeröhre EM 80 (6E1)
In den Datenblättern werden die Pinbelegungen von Röhren nicht wie bei
ICs von oben gesehen, sondern von der Unterseite dargestellt. Damals
konnte beim Einbau in ein Chassis sofort die Lage der Pins auf dem
Sockel erkannt werden. Die Anzeigeröhren haben 9 Pins für einen
Novalsockel.
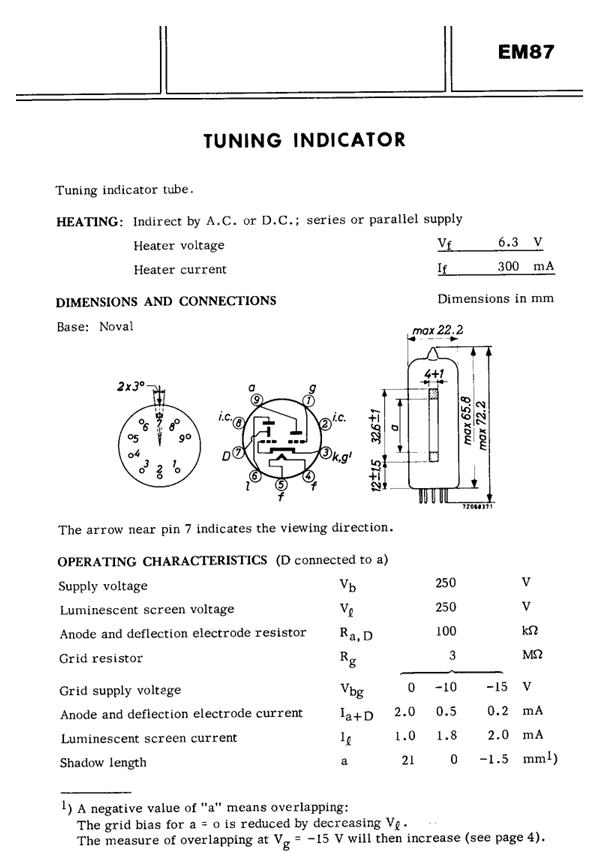
Abb. 4: Datenblatt für die EM 87 (6E2)
Für Bastler fehlten bislang Module für die Spannungsversorgung der
Anzeigeröhren. Aufgrund der lebensgefährlich hohen Anodenspannung ist
eine Nutzung der Platinen und Anzeigeröhren nur für fachkundige
Erwachsene geeignet. Die Röhren werden sehr heiß und können eine
Temperatur bis 120°C erreichen. Chinesische Händler bieten im Internet
eine preisgünstige Platine mit einer 6E2 an, die laut Datenblatt eine
Betriebsspannung von 250 VDC und eine Heizspannung von 6,3 Volt
erfordert (Abb. 5 und 6). Ein Trafo mit einem Gleichrichter ist jedoch oft zu
groß und zu schwer für einen nachträglichen Einbau des nostalgischen
Magischen Bandes in einen Verstärker oder in ein Radio.

Abb. 5: Chinesische Platine mit der 6E2 und Anschlüssen für 250 VDC Betriebsspannung und 6,3 Volt Heizspannung
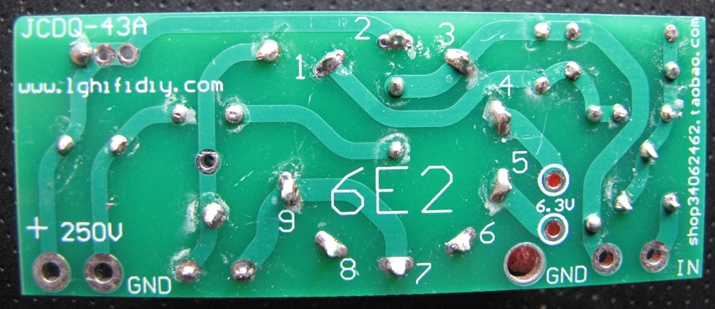
Abb. 6: Chinesische Platine zur Spannungsversorgung der 6E2 von unten gesehen
Zu diesen alten Anzeigeröhren haben chinesische Ingenieure neuerdings
mit Halbleitern bestückte Platinen entwickelt, die die erforderliche
hohe Anodenspannung und die Heizspannung aus der Spannung eines 6-Volt-
bzw. eines 12-Volt-Steckernetzteils bereitstellen.
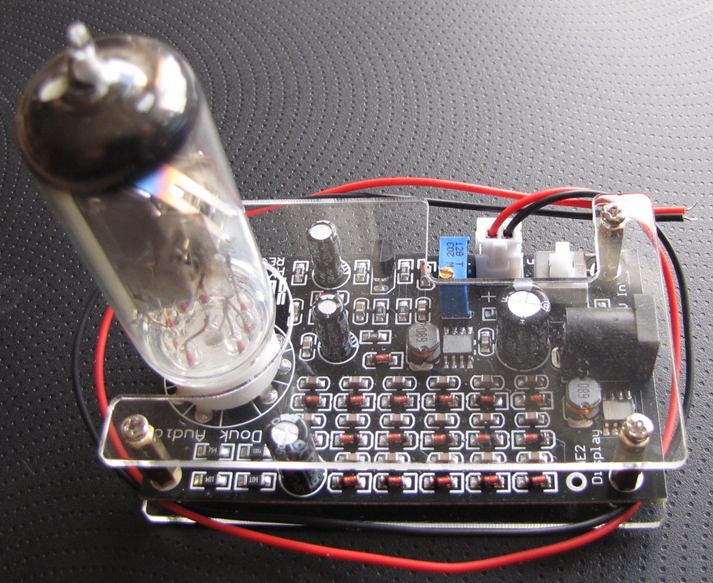
Abb. 7: Platine im Acrylgehäuse mit der 6E2
Eine durch Acrylplatten geschützte Platine mit der 6E2 zeigt Abb. 7.
Auf der Platine sind eine Steckverbinder-Buchse für ein 6 VDC Netzteil,
ein Druckschalter sowie ein Poti für die Regelung der Steuerspannung
aufgelötet. Die Anodenspannung von ca.132 VDC wird mithilfe von
Kaskaden von Dioden und Kondensatoren zur Spannungsvervielfachung
erzeugt. Platinen für den Anschluss unterschiedlicher Anzeigeröhren
zeigen die Abb. 8, 9 und 10. Sie sind mit einem Druckschalter, einer
Steckverbinder-Buchse für das Netzteil (9-15 VDC), einer Klinkenbuchse
für die Signalspannung sowie Lötaugen für ein Elektretmikrofon
versehen. Ein Poti zur Regelung der Signalspannung ist aufgelötet. Nach
Messungen des Verfassers liefert die Platine eine Anodenspannung von
ca. 195 VDC.
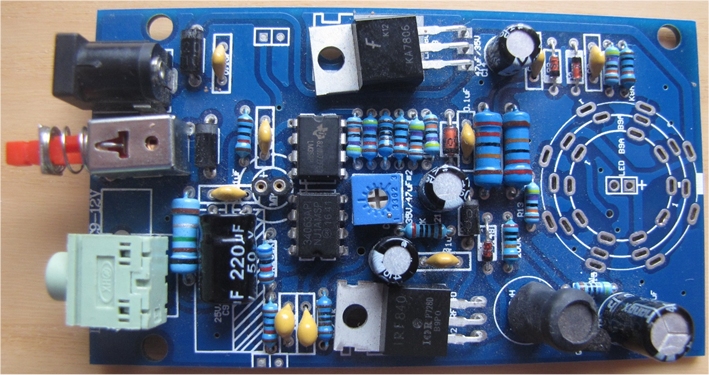
Bild 8: Platine für den Anschluss verschiedener Anzeigeröhren
Die Lötaugen im Innenkreises sind für den Anschluss des Sockels einer
6E2 (EM87, Magisches Band) vorgesehen. Es können ferner die
Anzeigeröhren EM84, EM800, PM84, UM87, UM84, 6E3P angeschlossen werden.
Die Zahl 1 markiert den Pin 1. Entgegen dem Uhrzeigersinn werden die 9
Pins gezählt, wobei die Pins 2 und 8 aufgrund interner Verbindungen
nicht angeschlossen werden müssen. Der mittlere Kreis der Lötstellen
ist für den Anschluss der älteren Röhre 6E1 (EM 80, Magischer Fächer)
bestimmt, die eine veränderte Pinbelegung aufweist. Bei der 6E1
brauchen die Pins 3, 6 und 8 nicht angeschlossen werden (Abb. 3). Der
mittlere Kreis dient auch der Spannungsversorgung der folgenden Röhren:
6E1P, 6BR5, EM81, UM80, UM81, 6DA5 und 19BRS. Der äußere Kreis der
Lötaugen ist für die Röhren 6E5C und 6E5S vorgesehen. Leider werden zu
den Platinen keine weiteren Informationen herausgegeben.
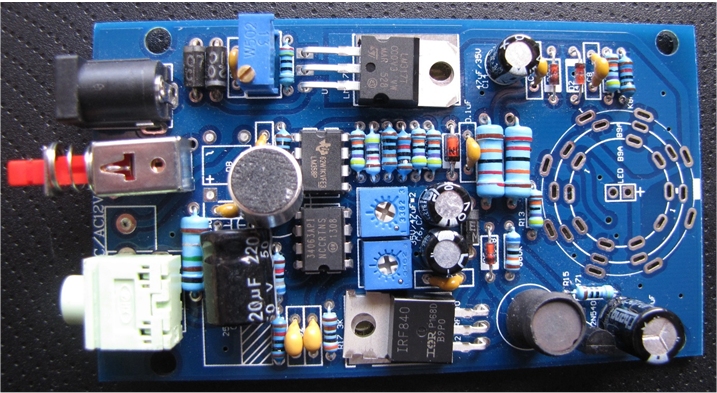
Abb. 9: Platine mit Elektretmikrofon und drei Potis für verschiedene Anzeigeröhren
Die Platine der Abb. 9 zeigt eine leicht veränderte Schaltung, da sie
drei Potis zur Regelung der Anodenspannung, zur Regelung der
Eingangsempfindlichkeit und zur Einstellung der Heizspannung besitzt.
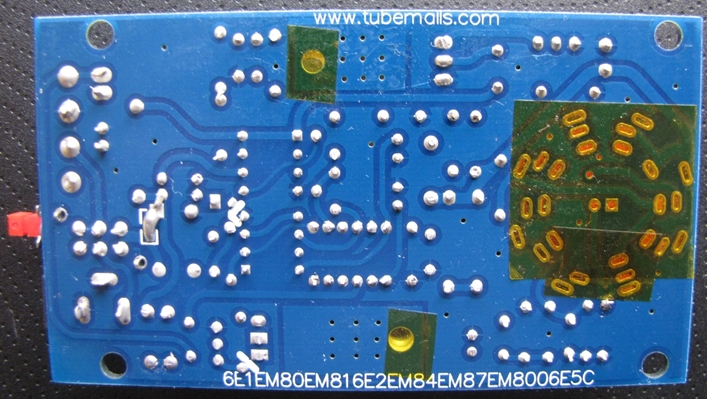
Abb. 10: Rückseite der Platine für verschiedene Anzeigeröhren
Beim Einlöten der Verlängerungsdrähte des Röhrensockels auf der
Rückseite der Platine ist die Reihenfolge der Pins natürlich im
Uhrzeigersinn zu zählen (Bild 10). Da der Franzis-Verlag einen Bausatz
für ein Röhren-Retro-Radio
für Kurzwelle anbietet, wurde das mitgelieferte praktische und
attraktive Gehäuse dazu genutzt, die Anzeigeröhren 6E1 und 6E2
einzubauen und zu erproben. Anstelle des Kurzwellenbausatzes
wurde jedoch der UKW-Radio Bausatz
von Franzis verwendet (Abb. 11). Das Steckbrett mit dem Empfangsmodul
TDA7088 und dem NF-Verstärkungschip LM386 wird zwischen Lautsprecher
und Röhre in das Gehäuse geklebt. Zuvor muss die Kartonhalterung des
Lautsprechers etwas gekürzt werden (Abb. 14).

Abb. 11: Bauteile für ein Radio im Franzis-Retroradio-Gehäuse mit
UKW-Radio-Modul TDA7088, NF-Verstärker LM386 und Anzeigeröhre 6E1
Das Radio arbeitet mit Halbleitern (Abb. 12), lediglich das
Gehäuse-Design und der Magische Fächer mit der 6E1-Röhre vermitteln den
nostalgischen Eindruck eines alten Empfängers aus der Röhrenepoche
(Abb. 1).
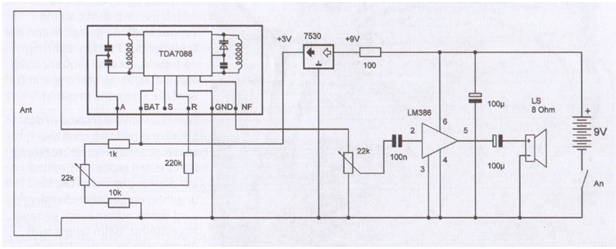
Abb. 12: Schaltplan von B. Kainka für das Franzis UKW-Radio
Nach dem Löten der Verlängerungsdrähte für den Röhrensockel und der
Anschlussleitungen zur 3,5mm-Klinkenbuchse des Steckernetzteils muss
noch die Line-In-Verbindung zum Steckboard hergestellt werden. Die
Lötfahnen des Röhrensockels müssen aus Platzgründen zur Seite gebogen
werden.
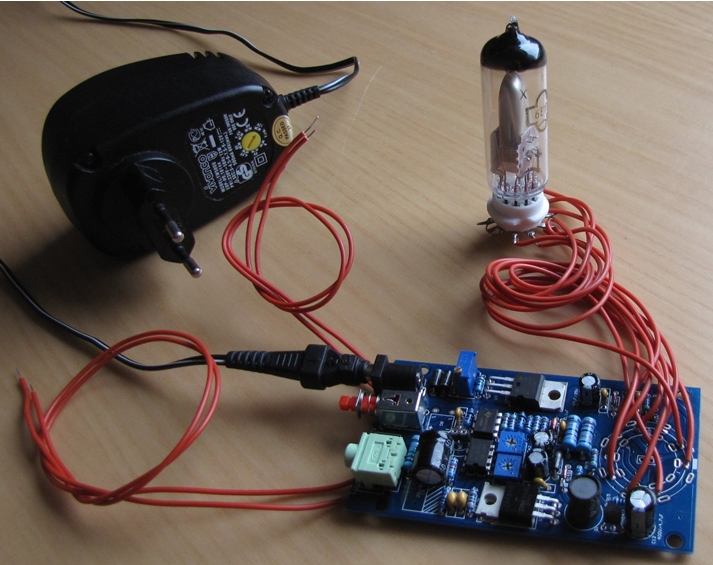
Abb. 13: Steckernetzteil mit fertig verdrahteter Platine und Röhre 6E1 vor dem Einbau in das Retro-Radio
Aufgrund der Länge der Anzeigeröhre wird diese vor dem Einbau des Potis
in die Kartonlasche geschoben. Das Potigehäuse muss mit einem kleinen
Stück Isolierband vor einem Kurzschluss der umgebogenen Lötfahnen des
Röhrensockels geschützt werden. Nach einer Funktionsprüfung kann die
Platine z. B. mit Heißkleber auf dem Gehäuseboden festgeklebt werden
(Abb. 14).
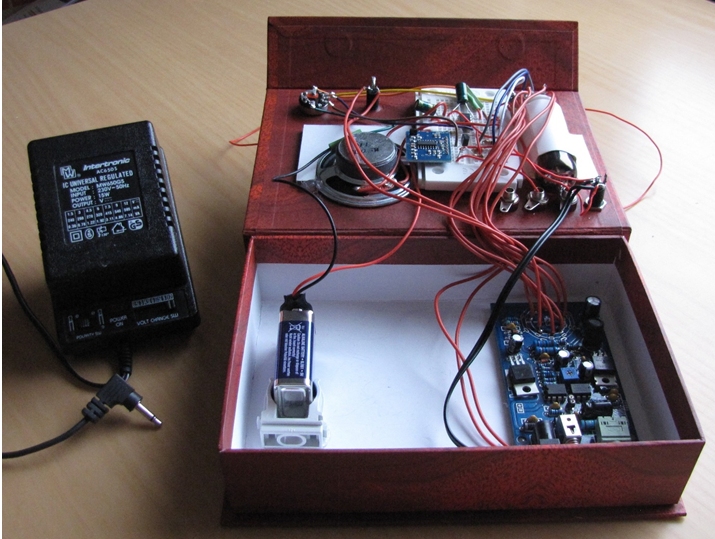
Abb. 14: UKW-Retroradio mit Magischem Band 6E2 und eingebauter Versorgungsplatine
Mit einer antiken russischen Anzeigeröhre, einer chinesischen Platine
mit Halbleitern und zwei Bausätzen vom Franzis-Verlag lässt sich ein
UKW-Retro-Radio bauen, das als nostalgisches Attribut einen flackernden
„Magischen Fächer“ (Abb. 1) oder ein „Magisches Band“ (Abb. 15) besitzt.

Abb. 15: Magisches Band der Röhre 6E2 im Retroradiogehäuse von Franzis
s.a.
90 Jahre Radio- und Elektronikbaukästen – vom Kristalldetektor zum DSP-Empfänger
Umbau des Franzis-Röhrenradios für UKW
Das magische Auge