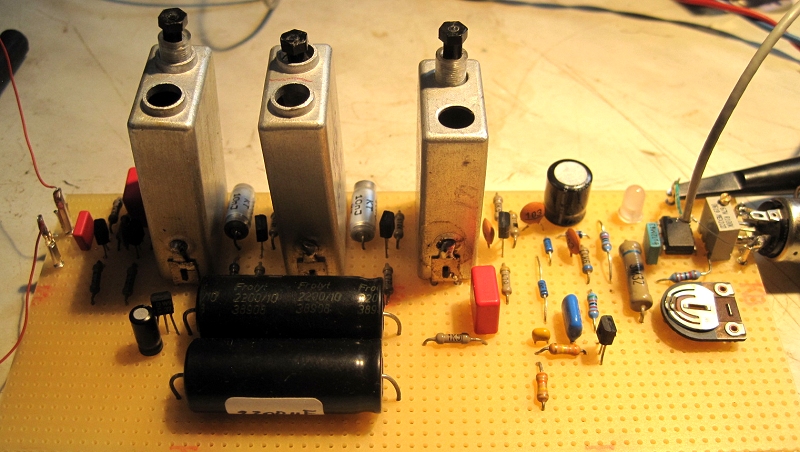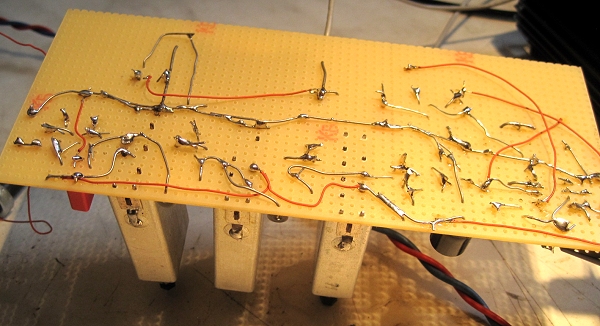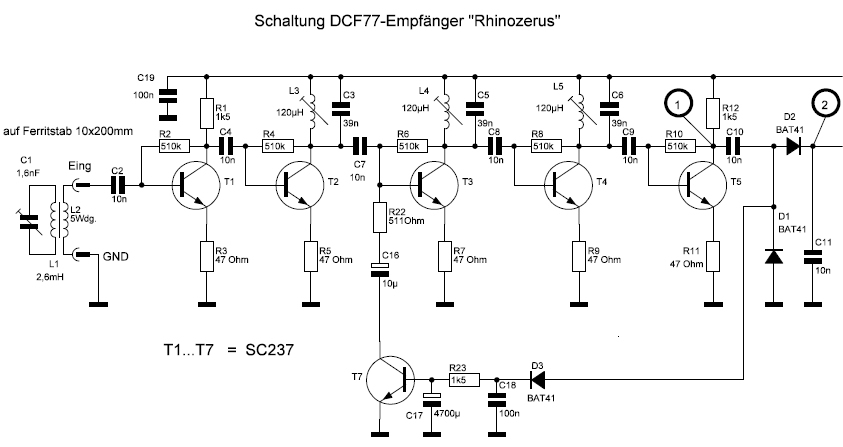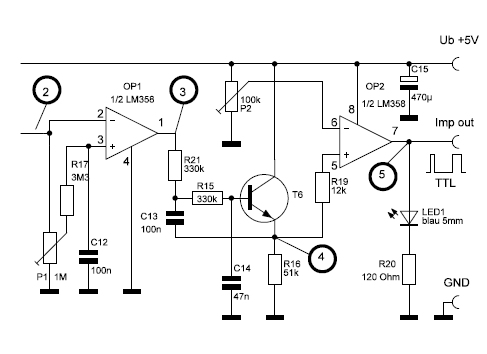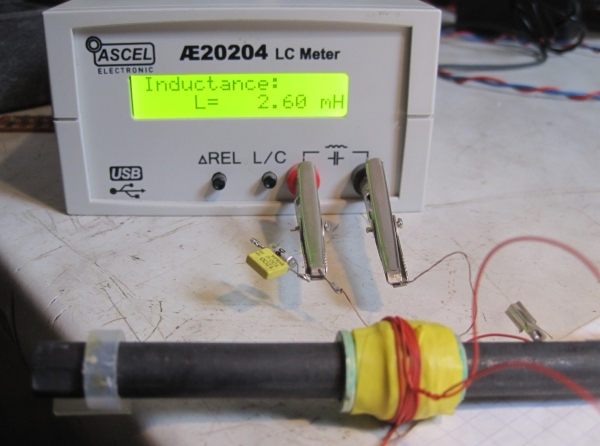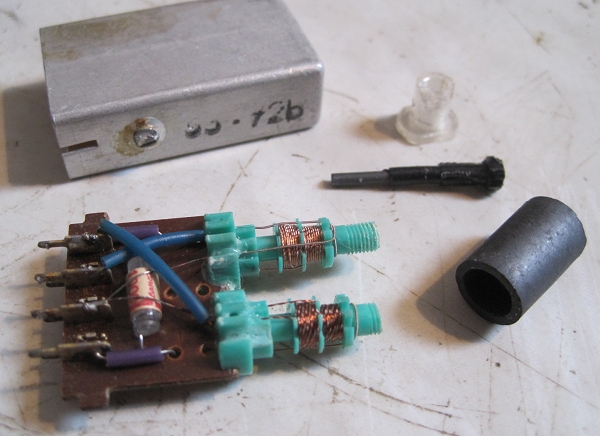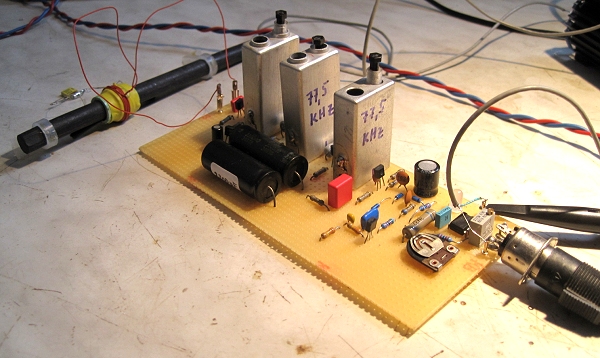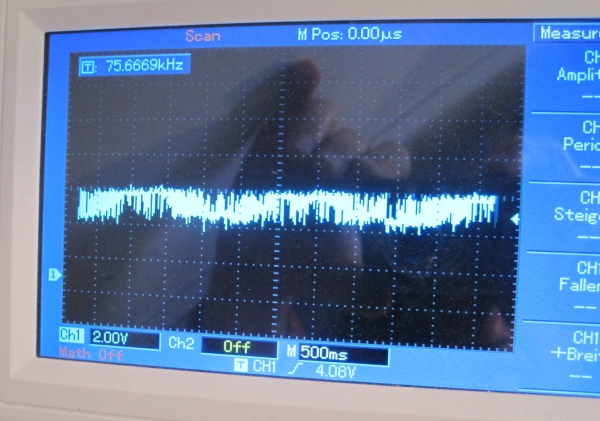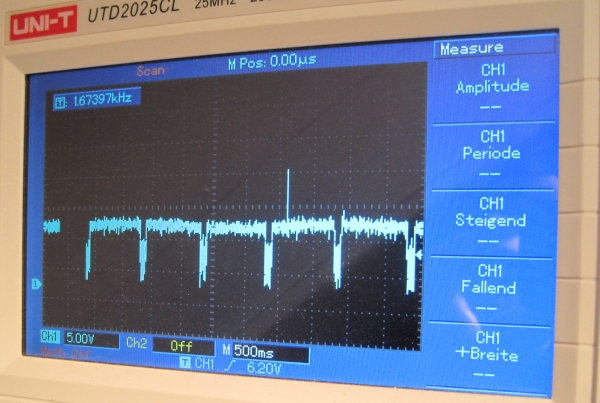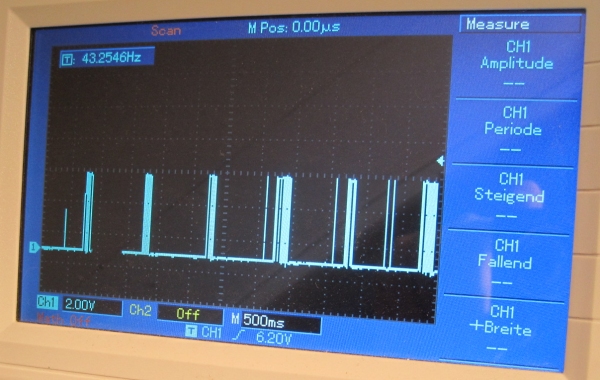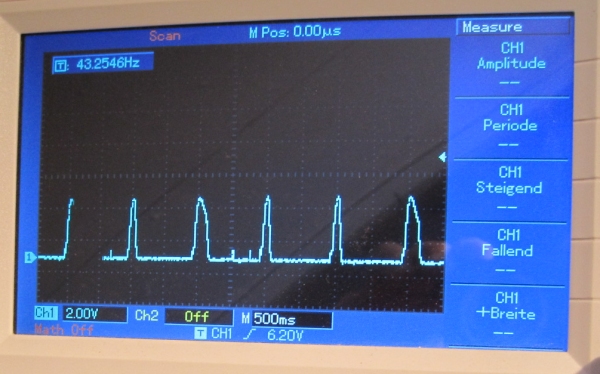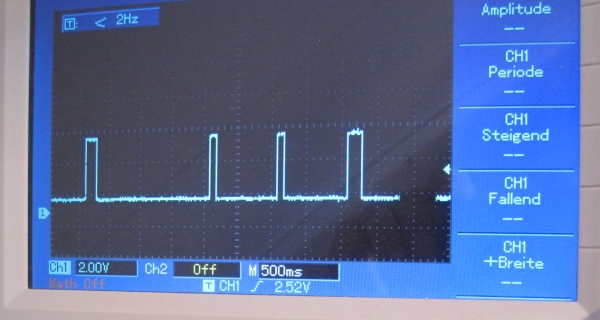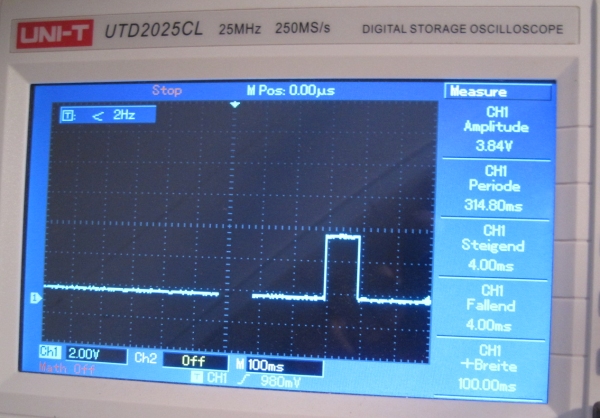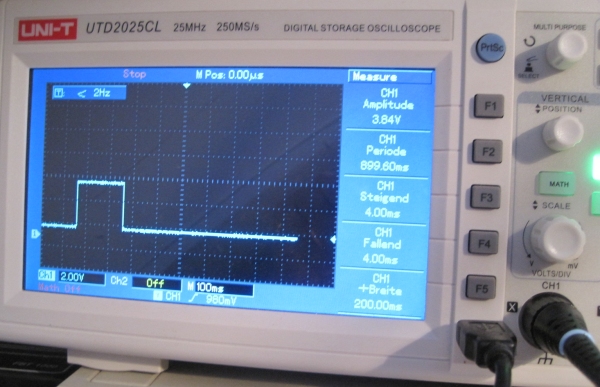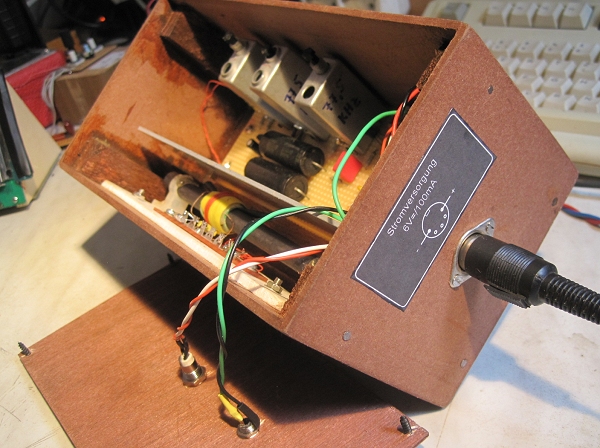Zeitzeichenempfänger „Rhinozerus“
von Günther Zöppel
Für
die Inbetriebnahme einer Nixie-Uhr brauchte ich ein
DCF77-Zeittelegramm. Dummerweise waren mir gerade alle vorhandenen
Fertigmodule (Pollin, ELV, Conrad, Reichelt) ausgegangen – diese waren
irgendwo in anderen Uhren verbaut, die ich nicht demontieren wollte,
und so habe ich aus vorhandenen Bastelkistenteilen, die mich keinen
Cent kosteten, einen ziemlich empfindlichen Empfänger gebaut, der zwar
gegenüber den Fertigmodulen etwas groß ausfällt, dafür aber
hervorragend funktioniert, auch unter Bedingungen, wo normale Funkuhren
schon aufgeben – z.B. im HF-mäßig ungünstigen Bastelkeller neben einem
eingeschalteten PC.
Schaltungsbeschreibung
Ich
habe mich auf ein Geradeausempfänger-Konzept orientiert, da bei einigen
Vorversuchen keine nennenswerten Nachteile gegenüber einer
Superhet-Realisierung zu verzeichnen waren.
Da
bei DCF77 die Information nur in einer Trägerabsenkung codiert ist, muß
der Empfänger allein eine diskrete Frequenz empfangen können, und das
kann man auch mit dem Geradeaus-Prinzip sehr selektiv hinbekommen. Der
Eingangsschwingkreis wurde auf einem Ferritstab 10x200mm untergebracht,
wobei eine gerade vorhandene Langwellenspule aus einem alten Radio zum
Einsatz kam, die (siehe Bild) mit 2,6mH Induktivität und den dazu
berechneten ca. 1,6nF die Resonanz auf 77,5kHz erwarten ließen,
was sich auch beim Nachmessen mittels Generator und Oszilloskop
bestätigte. Durch Verschieben auf dem Ferritstab kann man noch fein auf
Maximum abgleichen. Normalerweise verwendet man in der ersten Stufe
einen FET, um die Belastung des Schwingkreises klein zu halten – ich
hatte jedoch gerade kein passendes Exemplar zur Hand und habe daher den
ganzen Empfänger mit normalen Allerwelts-npn-Transistoren aufgebaut
(SC237 aus DDR-Restbestand, etwa vergleichbar mit BC547), an welche
aufgrund der niedrigen Arbeitsfrequenz von 77,5 kHz keine besonderen
Anforderungen gestellt werden müssen.
Damit
die Belastung des Eingangskreises trotzdem klein bleibt, wurde eine
Koppelwicklung von nur 5 Wdg. vorgesehen, die den Basiskreis der
Eingangsstufe bedient. Es schließt sich ein dreistufiger
Selektivverstärker an, der mittels umgebauter ZF-Filter auf 77,5 kHz
eingestellt wird. Die verwendeten Bandfilter (siehe Bild) sind alte
AM-Filter für ehemals 455kHz mit ca. 120 µH Induktivität (abgleichbar
von ca 50 -150 µH), diese wurden durch Tausch der vorhandenen
Parallel-C´s gegen 39nF zur Resonanz auf 77,5 kHz gebracht. Die Filter
sind durch den internen Aufbau mittels schalenkern-ähnlichen Ferriten
ziemlich resonanzscharf abgleichbar, auch im nunmehr neu zugewiesenen
Frequenzbereich. Durch Einspeisen von 77,5 kHz aus einem Generator in
den Eingang der Schaltung (ohne angeschlossenen Eingangskreis) konnte
ein Vorabgleich durchgeführt werden.
Am
Ausgang des Selektivverstärkers schließt sich noch eine Verstärkerstufe
an, die den Zweiweg-Gleichrichter bedient. Um die Verstärkung des
ganzen Traktes zu regeln, wurde noch eine relativ langsame
AGC-Schaltung eingesetzt (man hat es ja hier mit einem Nutzsignal im
Sekundenbereich zu tun !), die das ganze bei normalem Empfang auf ca.
600mV Richtspannung an Messpunkt 2 einregelt. Der gesamte
HF-Verstärker wurde durch Emitterwiderstände und die auf
Kollektor gelegten Basiswiderstände strom- und spannungsgegengekoppelt,
so dass er stabil ohne Schwingneigung arbeitet. Nach dem Gleichrichter
schließt sich ein Komparator an, der den neu eintreffenden
Sekundenimpuls mit einem aus der Richtspannung gewonnenen Pegel
vergleicht, welcher an C12 gepuffert wurde. Am Ausgang erhält man daher
die 100 bzw. 200 ms breiten Taktimpulse, die zur Auswertung
bereitstünden (Messpunkt 3). Der Arbeitspunkt des Komparators kann
durch den Trimmer P1 auf beste Impulsform eingestellt und nach Abgleich
durch Festwiderstände ersetzt werden. Es zeigte sich aber, dass diese
Impulse (siehe Oszillogramm Messpunkt 3) je nach HF-Störnebel in der
Umgebung relativ unsauber waren – daher habe ich noch einen Tiefpass
mit einer 3dB-Grenzfrequenz von ca. 10 Hz nachgeschaltet, ebenfalls
diskret mit T6 aufgebaut, der fast alle Störungen unterdrückt, welche
aus der hochfrequent verseuchten Umgebung einstreuen. Natürlich
verschleift ein solch schmaler Tiefpass auch das Nutzsignal etwas
(siehe Oszillogramm Messpunkt 4), aber das wurde mit einem weiteren
mittels P2 abgleichbaren Komparator beseitigt, der wieder exakte
Rechteckimpulse herstellt, welche dann mittels LED angezeigt werden und
relativ belastungsresistent am Ausgang für die Übernahme durch den
Decodiermechanismus der angeschlossenen Uhr im TTL-gerechten Pegel zur
Verfügung stehen.
Fazit
Mittels
geringem Aufwand wurde aus vorhandenen kostenlosen Altbauteilen ein
Empfänger geschaffen, der auch unter widrigen Empfangsbedingungen ein
brauchbares Zeittelegramm abliefert. Es ist geplant, noch ein
ansprechendes Gehäuse dafür herzustellen und ihn an einer zentralen
Stelle am Arbeitsplatz zu installieren, um alle Geräte damit zu
bedienen, die einer genauen Zeitinformation bedürfen. Eventuell sind
dafür noch weitere Pufferverstärker (einer je Ausgang) einzubauen. Auch
die Trägerfrequenz von 77,5 kHz ließe sich so (z.B. am Messpunkt 1)
auskoppeln, um als Referenz für ein Frequenznormal zu dienen, da sie ja
sehr konstant anliegt.
Taufe
Wie
alle meine Projekte bekommt auch dieser Empfänger einen eindeutigen
Namen, und so verleihe ich ihm feierlich den schönen Namen
„Rhinozerus“ ( Relativ HIstorisch-NOstalgischer
Zeitzeichen-Empfänger Resonanzscharf Und Störsicher). Möge sein
elektronisches Leben in der Welt der konkurrierenden Mikromodule von
Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit gekrönt sein.
Pockau, im September 2015
Günther Zöppel
Literatur und Quellen :
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html
http://home.arcor.de/df6vb/dcf77rx2.htm
http://www.brennecke.org/?page_id=1732
https://www.meinbergglobal.com/english/archive/emp226.htm
http://www.mikrocontroller.net/topic/354508
http://www.mikrocontroller.net/attachment/7395/DCF_77_EMPF_02.jpg
Messpunkt 1 - HF mit Sollfrequenz, etwas verrauscht und gestört durch PC-Einfluss
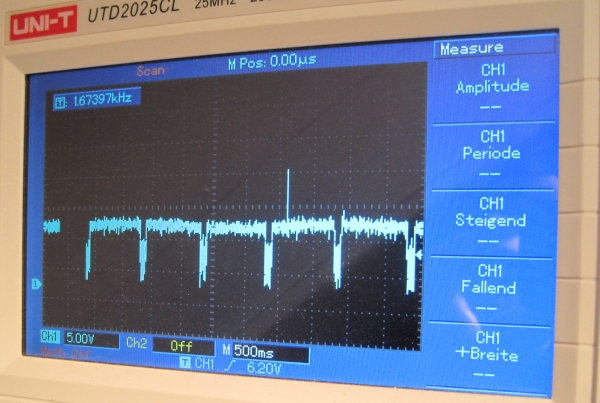
Messpunkt 2 - gleichgerichtete Impulse
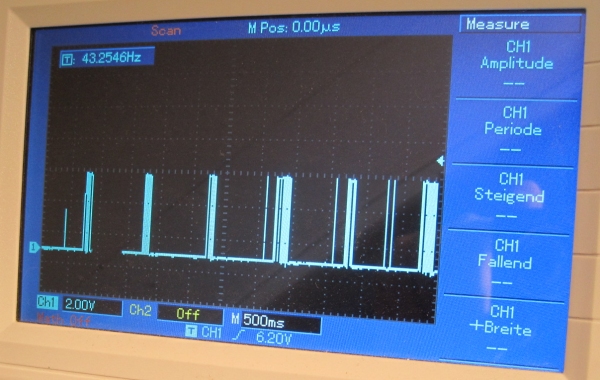
Messpunkt 3 - Impulse nach Komparator, man sieht Fehlimpulse (Störungen)
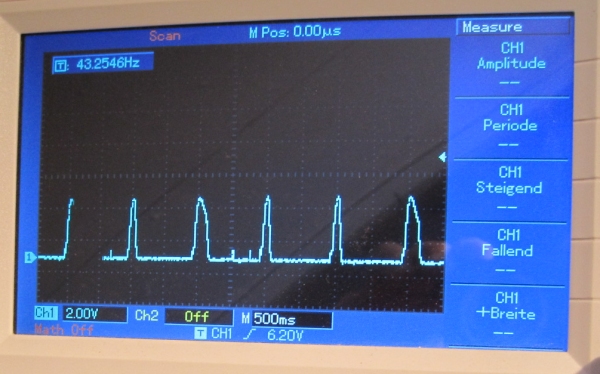
Messpunkt 4 - ausgefilterte Störungen nach Tiefpass
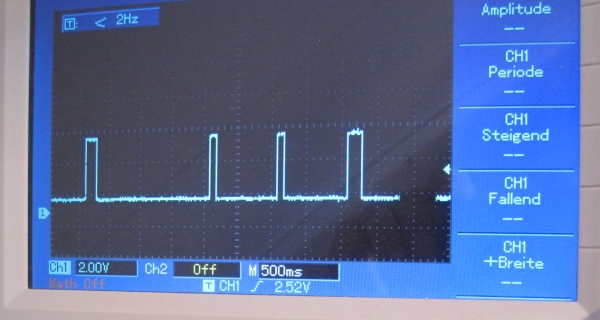
Messpunkt 5 – Ausgang nach Komparator, Impulse sauber ohne Störungen
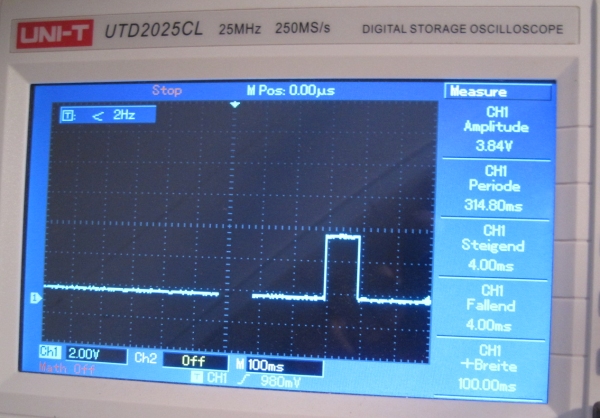
Messung 100 ms - Nachweis der exakten Einhaltung der Impulsbreite (siehe rechts unten
Anzeige der Breite)
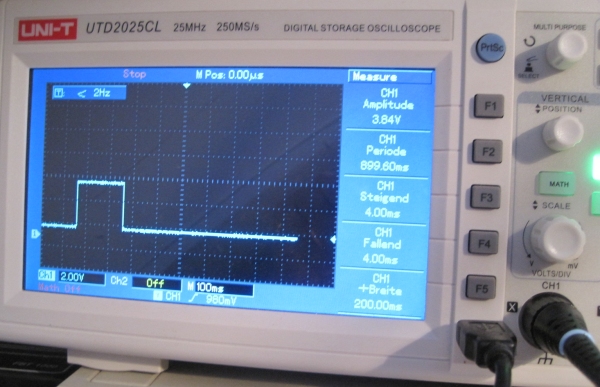
Messung 200 ms – ebensolcher Nachweis für den breiteren Impuls

„Rhinozerus“ im selbstgebauten Gehäuse. Eine Abschirmplatte zwischen Antenne
und Empfängerplatine wurde zusätzlich eingebaut und verhindert Rückwirkungen
vom Empfänger auf die Antenne.
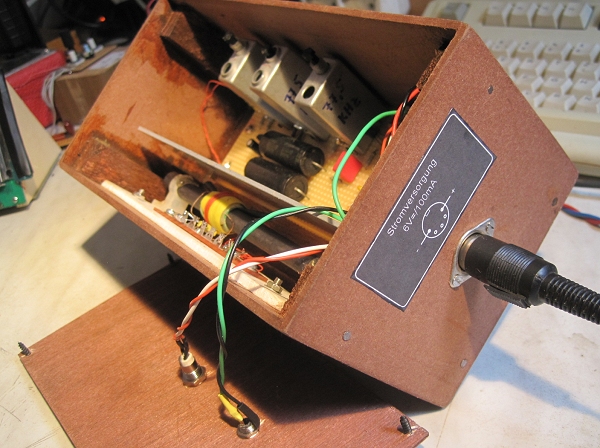
Seitenansicht, Buchse für Stromzufuhr. 6V wurden gewählt, weil eine zusätzlich
eingebaute Si-Diode zwecks Verpolschutz die Betriebsspannung um 0,7 Volt
verringerte. So bleibt der TTL-Pegel im Rahmen, obwohl der Empfänger auch mit
4,3 V arbeitet.

Zusammengebaut . hier habe ich gerade mal ein High beim Impuls im Foto
erwischt, die blaue LED ist an

Diese Nixie-Uhr lässt sich ganz hervorragend mit meinem Eigenbau
synchronisieren.